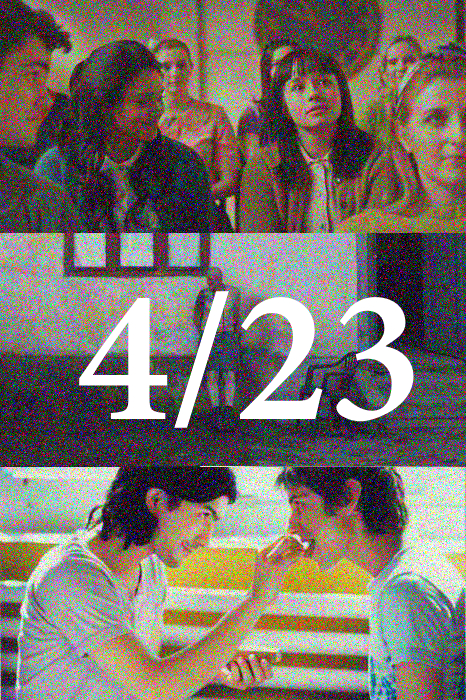
Sturzrevue & Kurzreplik — April ’23
Mit neuen Ritualen ist es immer so eine Sache. Meistens entstehen sie spontan, wildwüchsig und damit auch unregelmäßig, unzuverlässig, was sie erst ab einer gewissen Zeit dann erst wirklich zu einem Ritual macht. Manche Rituale werden hingegen planmäßig durchgesetzt, mit einem gewissen Zwang, beginnend mit einer rationalen Erkenntnis über dessen Notwendigkeit. Die spontanen Wildwüchse sind wohl eher der Kaffee und/oder Zigarette am Morgen, die meisten Daily-Work-Out-Routinen gehören aber meistens eher zur zweiten Sorte, die man immer auch mit ein bisschen Gewalt gegen sich selbst und Widerstände des Alltags durchsetzen muss.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ein monatlicher Rückblick auf Gesehenes und Gelesenes und womöglich sogar Erlebtes? Für einen Blog ja ohnehin keine sonderlich revolutionäre Idee. Mir macht diese Idee einerseits Lust auf Chronizität, Nachträglichkeit und einer neuen (freieren) Form des Ausdrucks, aber auch Angst. Angst vor der eigenen Neurose, die einen leiden macht. Angst vor den Strapazen des Alltags, die das Ritual mit dem Beigeschmack des Ach-ich-müsste-ja-noch belegt. Aber egal. Machen wir einfach mal. Stürzen wir uns hinein.
G E S E H E N :
„Sparta“ (Ulrich Seidl, 2022): Zwiegespalten, nicht so sehr wegen Seidls Art Filme zu machen oder dem Begleitdiskurs, den der Film umweht, da: schwer restlich aufzuklären. An Seidls Filmen schätze ich den unorthodoxen Humanismus, randständigen Figuren der Gesellschaft in ihrer Eigenheit zu zeigen, auch in ihrer Toxizität und Problembehaftetheit, aber eben ihrer Authentizität. Sich damit durch Zusehen auseinanderzusetzen, schärft in meinen Augen ein Gefühl für die Anderen der Gesellschaft. Aber: Mir persönlich scheint die (grundsolide) Interpretation Georg Friedrichs der wohl tatsächlich tatsachenbasierte Pädophilenperson zu sehr auf eine bestimmte, gewollte Grundabsicht hingebürstet zu sein. Nämlich das gute Werk eines Menschen mit einer schlechten Sexualität auszustellen. Ein bisschen zu sehr ein Seht-her. Konkret gesprochen zerfällt der Film für mich auch zu sehr in zwei Hälften eines recht behäbigen Beginnes und eines gelungenen, an den Humor der Romanian New Wave erinnernden Finales. Noch ausstehend, wie sehr mir der Film im Verbund mit „Rimini“ als „Böse Spiele“ gefallen wird. So ganz wie vollwertige, stringtente Seidl-Filme fühlen sich nämlich beide nicht an.
„Vienna Calling“ (Philipp Jedicke, 2022): Sympathische, lustige Wiener MusikerInnen machen sympathische, lustige Dinge, sagen sympathische, lustige Dinge. Unterhaltsam. Aber natürlich auch nicht viel mehr als ein Imagefilm mit Drohnenaufnahmen. Und natürlich auch schade, dass Samu Casata letztlich doch kein Konzert im Kanal gegeben konnte, wegen: Wettervorhersage. Irgendwie auch sinnbildlich für Wien, als eine sympathische, lustige, aber in letzter Konsequenz auch nicht sonderlich eskalative Stadt.
„What Happened Was …“ (Tom Noonan, 1994): Manche Filme sind über ihre Prämisse bereits formalästhetisch über ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, über einen unique selling point abgesichert. „What Happend Was …“ ist erst einmal der Film, der ein Hausbesuchdate als Kammerspiel zeigt, sich auf kleine Missverständnisse und psychologische Momente konzentriert und damit im Publikum Wiedererkennungswerte generiert. Das macht er auch meistens ganz gut, obwohl er hier und da zu „geschrieben“ und theatral wirkt und mir persönlich die Ausflüge in das Surreale bzw. in die ultrasubjektive Anxiety ab Mitte-Ende des Filmes auch als Fehlentscheidung, da irritierend erscheinen. Auch sonst gelingt dem Film das Aufrechterhalten der Spannung seiner Grundprämisse nicht immer gleichbleibend gut. Trotzdem wird Noonans Film natürlich immer dieser Pionier des Datingfilms als psychologisches Kammerspiel bleiben, den man sich spätestens immer dann ansehen wird, wenn man eine ähnliche Idee für einen Film hat.

„Farewell To Dream“ (Keisuke Kinoshita, 1956): Auch in der japanischen Nachkriegszeit werden die Karten der gesellschaftlichen Machtteilhabe neugemischt, sodass sich die wunderschöne Toyoko, Tochter eines einfachen Fischhänders, Hoffnungen machen kann, sich einem jungen, aufstrebenden Geschäftsmann im neu-kapitalistischen Japan hochzuheiraten. Währenddessen bleibt sein jüngerer Bruder mit der Frage konfrontiert, ob er das Geschäft des kranken Vaters weiterführen wird oder Segler wird wie sein idealisierter Onkel, der im Krieg gefallen ist. Viele starke Momente und feine Beobachtungen stehen einer etwas quietschig-überzeichneten Mädchenfigur der Toyoko gegenüber, die als unintelligent und launisch immer auch am Rande zum Sexismus charakterisiert wird.
„Decision To Leave“ (Park Chan-Wook, 2022): Eine der überschätztesten Filme des Jahres von einem der überschätztesten Regisseure des Weltkinos. Die Ästhetik von „Decision To Leave“ ist ein uninteressanter Netflix-Stil (ohnehin im koreanischen Kino grassierend), die Bilder sind zu hektisch, die Erzählung zu wirr und unübersichtlich. Überforderung, die einfach nur enerviert. Entweder man erzählt die Geschichte auf vier-fünf Stunden ausgedehnt in Ruhe (meinetwegen auch als Netflix-Serie) oder man dünnt sich entsprechend aus und kann sie auch in anderthalb Stunden erzählen. So viel wirkliche Erzählsubstanz ist da nicht. Und ohnehin funktioniert die Wertschätzungsrhetorik der Decision-To-Leave-Fans auch nur, weil es ja ach so sehr eine Hommage an Hitchcock ist. Der hat das aber alles schon besser hinbekommen.
„Fögi Is A Bastard“ / „De Fögi isch en Souhund“ (Marcel Gisler, 1998): Aus Gründen, selbst gerade ein Drehbuch mit homosexuellen Hauptfiguren zu schreiben, beschäftigte ich mich diesen Monat mit den Filmen Marcel Gislers. Man merkt im Gegensatz zu den gegenwärtigen LGBTQ-Filmen, die oft etwas selbstbezogen das eigene Milieu als eine Art Paradies unter dauerhaftem Beschuss von außen zelebrieren, geht es in seinen Filmen viel mehr um Beziehungen an sich, die — seien sie nun homosexuell oder nicht — natürlich auch dysfunktional, toxisch, missbräuchlich sein können. „Fögi Is A Bastard“ könnte Gislers Schlüsselwerk sein. Die Romanadaption zeigt die Beziehung eines Fans zu einem Musiker, eines Minderjährigen zu eines Mittzwanzigers, eines Kindes also zu eines Kindgebliebenen. Das Psychologische reagiert in „Fögi Is A Bastard“, fantastisch gescastete Schauspieler interpretieren ihre Figuren in Szenen, die etwas selten erlebt Formelloses und Frisches an sich haben.
„Sick Of Myself“ (Kristoffer Borgli, 2022): Ein schwieriger Film, den man im Grunde auf zwei Weisen sehen kann. Entweder man nimmt die Figuren als solche ernst, was nicht ganz abwegig ist, denn das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit (und Liebe) der Hauptfigur hat schon empathische Anknüpfungspunkte, die am Anfang auch bedient werden. Aber verfolgt man den Film auf dieser Fährte, wird man den ihn womöglich eher hassen. Denn im Grunde ist „Sick Of Myself“ auch sick of its own characters. Die Figuren sind nur Funktionsträger eines extrem zynischen Sketchspiels, was nun nur zweiten Weise des Sehens führt: Als Planspiel über Aufmerksamkeitsökonomie und zeitgeistiger Narzissmus funktioniert „Sick Of Myself“ ziemlich gut. Die Dialoge sind immer mindestens solide, manchmal aber auch brillant und so messerscharf geschrieben, dass man sich davon versehentlich eine Fleischwunde abholen könnte. Bitterböse und ein bisschen auch eklig. Eklig-zynisch. Ein Drecksfilm. Aber irgendwie eben auch gut. Und die Kamera verdient in dem genauen Wissen darüber, was sie zeigen will und wie, ein extra Lob.

„Die blaue Stunde“ (Marcel Gisler, 1991): Schon 1991 in „Die Blaue Stunde“ zeigt Gisler das Interesse an (mutmaßlich autobiografischen) Erlebnissen als Homosexueller, gleichermaßen aber auch an Charakterforschungen in das Dunkle und Manipulative des seiner Figuren hinein. „Die blaue Stunde“ handelt von einem gutaussehenden Schwulen in Berlin, der sein Geld als Callboy verdient und damit im Grunde genommen nicht nur Geld verdient, sondern auch Spaß und Selbstbestätigung durch den Verschleiß eines nie endenwollenden Meeres an homosexuellen Männern erfährt. In einer Kernszene des Films bemerkt er an sich selbst, dass ihn das zu einem kühlen Menschen macht. In einer anderen Szene bemerkt er selbst, wie er gegenüber der hingebungsvollen Nachbarin kaum mehr authentische Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Die Auseinandersetzung mit Niederungen menschlichen Umgangs: ein wiederkehrender Topos bei Marcel Gisler.
„The Ordinaries“ (Sophie Linnenbaum, 2022): Hierüber muss noch an anderer Stelle mehr die Rede sein, denn mir scheint, den wenigsten ist bewusst, WIE politisch dieser Film ist und wie grandios das alles ist.
„Suzume“ (Makoto Shinkai, 2022): Mal gut, dass es in Japan so gute und zuverlässige Closer (Schließer) gibt, denn mit der Frequenz wie ohne die Hilfe der heroischen Wächter der Parallelwelttore anscheinend ein dämonischer Wurm aus dem Jenseits dort ausbrechen und damit Erdbeben erzeugen würde, gäbe es dort Katastrophen wie Fukushima dort wohl jedes Wochenende. Spaß beiseite. Makoto Shinkai ist wohl sowas wie die neue Hoffnung der Anime-Auteurfilme, wobei durch die Verbindung mit Computereffekte, die Filme gleichermaßen einen foto-realistischen, aber eben auch sehr synthetischen und charmelosen Charakter bekommen. Ein bisschen erinnert der Film also nicht nur in seiner Erzählwelt an Christopher Nolan, sondern auch in seinem ästhetischen Selbstverständnis.
„Sterne unter der Stadt“ (Chris Raiber, 2022): Ein bis zur Geschmacklosigkeit kitschiger Jeunet-Epigone, der insbesondere im Drehbuch eklatante Schwächen aufweist. Motive werden eher wiederholt, als wirklich weiterentwickelt. Alle Erzählmomente sind vorhersehbar und ohnehin rein kompilativ. Das Schlimmste am Film ist aber, dass er im Grunde eine reine Rechtfertigungsideologie für creepiges, männliches Verhalten darstellt, Frauen nachzustellen, nur weil man ja ein romantischer-liebenswerter Freak ist (für den der Schönling Thomas Prenn ohnehin die falsche Besetzung ist). Dass Verena Altenberger (die noch das Beste am Film ist) mit ihrem ausschließlich für diesen antifeministischen Film glattrasierten Schädel eine Feminismusdiskussion in Österreich auslöste, gehört zu den Begleitironien dieses Films.

„Blue Jean“ (Georgia Oakley, 2022): Eine gute Hauptdarstellerin und teils sehr spannende Nebenbesetzungen (Lucy Halliday ist sicher eine Entdeckung!) können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Drehbuch arg didaktische Züge hat und nie wirklich an Grip gewinnt. Die Kamera versucht sich mit einem Analog-Look am Zeitkolorit der Thatcher-Jahre. Was an sich i.O. wäre, die Anleihen an Ästhetiken eines 80er-Jahre-Horrorfilms wie Zeitlupen oder ein scary schriller Score bleiben aber sinnlose Effekthascherei.
„Feminism WTF“ (Katharina Mückstein, 2023): Knallige Reportage mit musikvideoartigen Farben- und Tanzcollagen. Das filmische Pendant zu irgendwas zwischen Nautilus-Flugschrift-Kampfblatt und Bravozeitung. Statementhaft, immer auch darauf bedacht, ein bisschen cooler sein zu wollen als nur die Talking Heads, aus denen der Film summa summarum dann aber eben doch hauptsächlich besteht. Die Klassenfrage innerhalb des feministischen Diskurses wird dabei nur in einigen Nebensätzen abgehandelt. Dadurch, dass der Film darauf bedacht scheint, rhetorisch geschlossen zu sein, findet er keinen Weg diskursive Widersprüche1 adäquat als solche abzubilden.
Out of competition: „Menuett“ (Hans Broich, 2023), „Heimsuchung“ (Achmed Abdel-Salam, 2023)
G E L E S E N :
„Kokain“ (Pitigrilli, 1921): 100 Jahre alt und erstaunlich aktuell, zeigt „Kokain“ die Geschichte einer zunehmend kosmopolitischen hedonistischen Jugend mit kaum erfüllbarer innerer Leere. Man könnte sich dieselbe Geschichte eines kokainsüchtigen Journalisten ohne viel Mühe auch zwischen Backstage-Bereich und Vice-Redaktion vorstellen. Aber die Aktualität ist dabei nicht einmal das Beste an dem Buch. Mit gerade einmal 28 Jahren veröffentlicht der Italiener Pitigrilli einen Roman von unnachahmlicher Dreistigkeit und Verschmitztheit. Es ist ja gerade das Wissen über das eigene Schreibarsenal das die Reife eines Autoren bestimmt. Welche Haltung darf ich wieweit einnehmen, was muss mir wichtig sein, was darf mir scheißegal sein? Natürlich könnte man sagen, dass solche Fragen nicht nur mit Lebenserfahrung beantwortet werden können, sondern auch durch den Genuss von Kokain bei Seite geschoben werden können. Wie dem auch sei: Es ist eben gerade diese Kompromisslosigkeit des eigenen Umgangs mit Hauptfigur, der Handlung und insbesondere dem fast schon verächtlich-zynischen Verhältnis zum Leser, was an „Kokain“ so beeindruckt. Immer wieder rückt der Erzähler für einen Moment aus der Diegese heraus und kommentiert den eigenen Erzählbogen. Damit dürfte Pitigrillis Geschichte vom Kokainisten und Lebemann Tito inspirierend für so manchen Verteter der Gegenwartsliteratur gewesen sein, in dem das lustvolle Spiel mit dem Medium ja recht modisch ist, insbesondere in dem läppischen Tonfall wie bei Pitigrilli. Daher kann man nur zurückgeben, was Pitigrilli an einer Stelle über Priester und Rabbiner zu sagen hat: „Bewunderungswürdig wie alle geschickten Betrüger„
„Die Entdeckung der Currywurst“ (Uwe Timm, 1993): „Kein Berufsstand ist durch gutes Essen so bestechlich wie die Arbeiter der Stirn.“ Nun, vielleicht, jedenfalls liebe ich Currywurst, ironisiere, ikonisiere sie gerne, weswegen es eine naheliegende Idee war, mir dieses Buch zum Geburtstag zu schenken. Uwe Timm verbindet hier das Große mit dem Kleinen: Geschichte des (scheidenden) Nationalsozialismus mit wiederkehrendem anekdotischem Witz, gesamtdeutsches Schicksal mit Hamburger Lokalkolorit und eine tragische Liebesgeschichte mit einer urigen Erzählklammer kulinarischer Erfindungskunst. Immer unterhaltsam und übersichtlich erzählt, selten wirklich fordernd oder virtuos.
„Die Vorbereitung des Romans“ (Roland Barthes, 2003): Die einführenden Worte des Suhrkamp-Verlags auf der Rückseite des Titelblatts könnten für sich stehend schon ein Gedicht sein: „Roland Barthes war 63 Jahre alt, als er beschloss, ein „neues Leben“ zu beginnen. Er wollte nicht mehr Vorlesungen über Literatursemiologie halten, sondern einen Roman schreiben. Es gelang ihm nicht. Statt dessen schrieb er eine Vorlesung über die Schwierigkeit, einen Roman zu schreiben. (…) Zwei Tage nach der letzten Vorlesungssitzung erlitt Roland Barthes am 26. März 1980 jenen Verkehrsunfall, an dessen Folgen er sterben sollte.“ Was für eine Ironie und was für ein Kommentar auf das unveränderliche Wesen des Menschen! Über 500 Seiten lang theoretisiert und systematisiert Roland Barthes über das Schreiben eines Romans, eben als seine „Vorbereitung“, einen eigenen Roman zu schreiben, endlich mit Mitte 60 seinen ersten Roman zu schreiben und dann stirbt er (womöglich weil er im Straßenverkehr an seinen Roman dachte!) und hinterlässt ein Leben und Werk, das sich ganz und gar eben dem Theoretisieren und Systematisieren von allem und jedem gewidmet hat.2 Diese Ebene der ironisch-tragischen Lebensleistung schwingt natürlich zwischen jeder Zeile dieser großartigen Vorlesungen mit, trägt zu deren Aura bei. Große Gedanken literatur- und kulturwissenschaftlicher Schwere liegen hier oft nur wenige Zeilen neben charmanten, persönlichen Bemerkungen, in denen Barthes manchmal wie ein kleines sehnsüchtiges Kind erscheint. Selbst banale Alltagssorgen des (schreibenden) Lesers finden hier immer wieder einen Seelenverwandten, wenn Barthes beispielsweise (statt endlich mit seinem Roman anzufangen!) darüber philosophiert, welcher Arbeitsplatz, welche Kleidung, welche Freizeiteinteilung, welcher Schlafrhythmus, welche Drogen die richtigen seien, um zu schreiben und immer natürlich seine Lieblingsautoren Kafka, Mallarmé, Flaubert, Balzac und natürlich Proust heranzieht. Hätte Barthes gewusst, dass er am 26. März 1980 stirbt, er hätte … dieses Buch wahrscheinlich trotzdem geschrieben.
Hinweis zu den Bildrechten: © unterliegt ihren jeweiligen Besitzern, Benutzung bezieht sich auf das Zitatrec
- z.B. wie dass Einbürgerungstests mit LGBTQ-Fragen einerseits als rassistische Annahme der Rückständigkeit vom MigrantInnen dargestellt werden, genau eine solche antiheteronormative Kulturpolitik aber auch vom Film selbst ganz klar eingefordert wird [↩]
- Und wer könnte sich damit besser identifizieren, als ich, der auch ein theoretisierender und systematisierender Filmemacher und Autor ist? [↩]