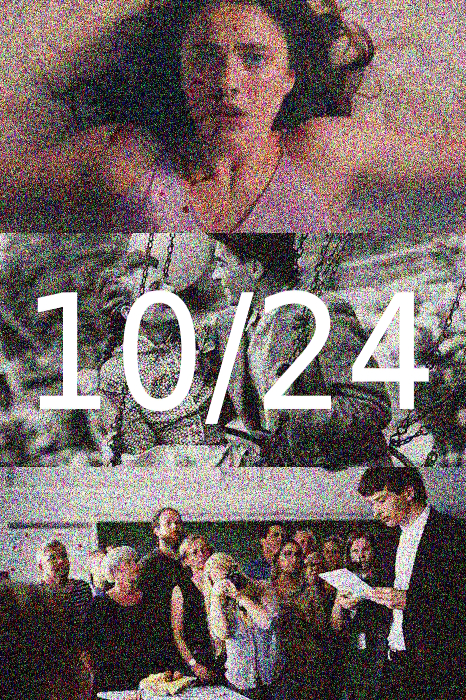
Sturzrevue & Kurzreplik — Oktober ’24
G E S E H E N :
„Servus Papa, See You In Hell“ (Christopher Roth, 2022): Obwohl Teile der Crew in die Geschichte der Otto-Mühl-Kommune sogar persönlich involviert waren (die Hauptfigur Jeanne Tremsal, gespielt von Jana McKinnon, spielt in dem Film ihre eigene Mutter, der Regisseur Christopher Roth ist Jeanne Tremsals Ehemann), leidet „Servus Papa, See You In Hell“ daran, die Geschichte nie ganz atmosphärisch oder psychologisch durchdringen zu können oder zu wollen. Otto Mühl bleibt ein oberflächliches Scheusal, halb Kind, halb Diktator, aber immerzu die Idee von diesem Kind-Diktator. Der Film schafft es nicht, tiefere Erkenntnisse über Machtmissbrauch, faschistoide Psychologisierung usw. zu gewinnen oder sie in aussagekräftige Kontexte zu überführen. Handwerklich ist der Film sträflichst konventionell gearbeitet, als wolle man den Film unbedingt für den Fernsehabend im Zweiten abgeben. Alles was man nach dem Schauen des Films über die oben genannten Themen weiß, wusste man auch vorher schon. Kein schlechter Film, ganz und gar nicht, aber auch weit davon entfernt, die Komplexität seines Themas auszureizen.
„Merry-go-round“ (Zoltán Fábri, 1956): Einer der allergrößten Klassiker des ungarischen Kinos: Was daran heute noch so bedeutsam sein soll, muss man ein bisschen mit der Lupe suchen, denn auf den ersten Blick folgt Zoltán Fábri a) einem gängigen Eifersuchtsplot des Heiratsmarktkinos der Nachkriegszeit und b) natürlich der damaligen sozialistischen Gesellschaftspropaganda recht sklavisch. Aber es sind nicht nur die ikonischen Karussell-Shots (sinn-bildlich für die größere „Attraktion“, die der Nebenbuhler Maté gegenüber dem Verlobten ausmacht), sondern durchaus auch dramaturgische Entscheidungen, die „Körhinta“ vom Durchschnitt abhebt. Anders als in den überwiegenden sozialistischen Liebesgeschichten, die sich an bösen Großbauern abarbeiten, kommt der Revolutionär hier nicht als gepiesaktes Opfer, sondern von Anfang an als ein moderner Mann mit Visionen und anderen Sitten, der in gewisser Weise die Zeit für sich spielen lässt. „Körhinta“ macht keinen Hehl daraus, dass er aus der Perspektive der (neuen) Mächtigem erzählt ist. Anders als die üblichen Vertreter des internationalen Revolutionskinos sind die gestrigen antisozialistischen Bauern hier auch durchaus noch einfühlsam als Menschen geschildert, die in ihren schlechten Momenten den niedersten Instinkten folgen, aber in ihren besten Momenten (die haben sie nämlich auch), aus sich selbst erkennen, das eine neue Gesellschaft am Horizont aufzieht, der man das Feld gewaltlos überlässt. So predigt „Körhinta“ letztlich einen friedlichen Übergang, der eine gesamtgesellschaftlich-versöhnliche Komponente einsingt. Vielleicht auch deswegen ist „Körhinta“ ein Teil der kollektiven ungarischen Erinnerung geworden.
„Stop Making Sense“ (Jonathan Demme, 1984): Die Talking Heads sind ohne Frage eine sehr begabte Band und es macht Spaß ihnen, beim Musikmachen zuzusehen. Auch ist „Stop Making Sense“ ein gut gemachter Konzertfilm, vielleicht sogar ein sehr gut gemachter. Man muss trotzdem dringend den Hype um „Stop Making Sense“ als Film eingrenzen, denn zu keinem Zeitpunkt transzendiert Jonathan Demme hier wirklich den Konzertfilm, der nunmal am Ende des Tages ein abgefilmtes Konzert (bzw. mehrere) ist, in eine Richtung, dass sich das als ein außerordentliches Kunstwerk definieren ließe. So bleibt doch der Eindruck, dass die kollektive Begeisterung für „Stop Making Sense“ zu (zu) großen Teilen auf den Hype um die Band Talking Heads entfällt.
„Memories Of His Scent“ (Kihori Higashi, 2024): Eine junge Hauptfigur namens Hinoki will den Geruch ihres Vaters festhalten und begibt sich auf eine Reise durch eine Handvoll Kinos, die sein Vater, ein Kaffeeröster, zuvor besucht hat. Dort schenkt sie dessen Kaffe aus. „Sehr gut“, schmeckt er, sagen die Nebenfiguren. Aber man sieht als Zuschauer, dass der Kaffee irgendwie sehr dünn aussieht, also meinen Geschmack schonmal kaum treffen wird. Und ein bisschen wie diese Szene ist auch der gesamte Film. Es mag ein bisschen fragwürdig sein, auf einen so kleinen, so unbekannten, halben Amateurfilm drauf zu dreschen, aber „Memories Of His Scent“ ist wirklich ein kompletter Reinfall. Ich mag Filme, die das Unmögliche versuchen, also Sinne erwecken zu wollen, die im Medium Film gar nicht abgedeckt sind, wie das Olfaktorische. Das kann logischerweise nur auf einem abstrakten Umweg der Evokation geschehen. Aber „Memories Of His Scent“ gelingt das zunächst einmal auf der audiovisuellen Ebene überhaupt nicht. Er ist ein geradezu hässlicher, dilletantisch kadrierter Film mit einer Colour-Correction aus einer braun-orangenen Hölle. Dann aber auch auf der Ebene erzählerischer Poesis nicht. Wir erfahren eigentlich nichts Wesentliches über irgendeine Figur und auch nicht über den verstorbenen Vater als eine Ansammlung skuriller Attribute, die immer irgend etwas mit (Geruchs)sinn, meistens mit Kaffee, manchmal mit Kino zu tun haben. Der Film geht dabei kompilativ vor und glaubt, wenn er nur oft genug irgendwelche banalen Gespräche über Sinnlichkeit aneinanderreihen würde, könnte irgendwann auch so etwas wie Sinnlichkeit entstehen. Ironischerweise scheinen die fruchtbarsten Zugänge zu der Handlung von „Memories Of His Scent“ eher unfreiwillige zu sein, jedenfalls werden sie von der Handlung nicht reflektiert, nämlich, dass die Suche Hirokis nach dem Geruch ihres Vaters eine stark erotisierende Note hat und sodann auch etwas sehr Narzisstisches, da sie die Lebenswelten ihrer Mitmenschen kaum sieht und alles nur durch das Leid ihres verlorenen (Über)vaters mitbekommt. Das geht so weit, dass sie sogar dann noch ihrem Vater über einen Lautsprecher nachweint, obwohl dieser Lautsprecher eigentlich dazu dienen soll, eine davongelaufene Sechsjährige zu finden.
„My Sunshine“ (Hiroshi Okuyama, 2024): „My Sunshine“ ist ein wunderschön in Analog fotografierter, kontemplativer Film über ein ungewöhnliches Ménge-à-trois aus einem jungen Loser, der beginnt sich für Eiskunstlauf zu interessieren, einer schönen Mitschülerin, die eben eine begabte Eiskunstläuferin ist und ihrem homosexuellen Trainer. Zwischentöne des Begehrens werden hier in der Regel nicht ausgesprochen, sondern den Bildern überlassen, was dem Werk einerseits den visuellen Kompositionen viel Interpretationsraum verleiht (in dem auch eine gewisse Pikantesse platzhat), andererseits teilweise auch Unklarheiten produziert. So ist z.B. lange nicht wirklich klar, ob der Blick des Jungen Takuya auf die eiskunstlaufende Mitschülerin ein sexuell motivierter ist oder er aber einzig der Lust am Eiskunstlaufen gilt. Und da der Film allgemein wortkarg ist, vollziehen sich also auch Gedanken, die hier und da ins Leere laufen und nicht ganz dieselbe Sinnlichkeit erreichen wie die eines ähnlich arbeitenden Regisseurs wie Sho Miyake. Aber zweifellos ist das ein sehr vielversprechender Zweitlingsfilm.
„Black Box Diaries“ (Shiori Ito, 2024): „Black Box Diaries“ ist im Prinzip ein Making-Of, ein begleitender filmischer Supratext zu der eigenen biografisch-journalistischen Reportage „Black Box“ von Shiori Ito, in der sie einen Vergewaltigungsfall im engsten Bekanntenkreis Shinzo Abes bekanntgemacht und damit Japans #metoo ausgelöst hat. Tagebuchartig filmt sie sich selbst bei ihren juristischen und journalistischen Schritten. „Black Box Diaries“ ist deswegen so spannend, weil er investigativ wirklich bis an die Zaunspitzen der großen japanischen Politik vorrückt und mindestens einen Fall von extremer Korruption und Vertuschung im japanischen Machtapparat stichhaltig nachweisen kann. Ein bisschen irritiert indes, mit welch Schulternzucken und Lächeln Regisseurin und Autorin Ito den Mord an Shinzo Abe kommentiert.
„Desert Of Namibia“ (Yoko Namanaka, 2024): Das Programmheft macht es einem leichter als der Film selbst, wo die Information über die Hauptfigur, das vermutlich eine bipolare Störung vorliegt, erst etwa nach 120 Minuten geteilt wird. Zwar ist die Darstellung von manischer Depression schauspielerisch glaubwürdig, aber es gibt auch keine wirkliche Haltung der Filmemacherin dazu. Vieles, was der 21-jährigen Satsuki trotz ihrer zwischenmenschlichen Auffälligkeit so zufällt, wäre einer weniger attraktiven Person sicherlich nicht so ohne weiteres zuteil, so sit „Desert Of Namibia“ wohl unfreiwilligerweise irgendwie auch ein Film über Beauty Privilege. Das sind mal die Vorbehalte gegenüber diesem Film, der es einem wirklich nicht leicht macht. Gleichzeitig beweist die Regisseurin Yoko Yamanaka auch ein großes Können, einen „free-floating“ Film zu machen, der also nicht nach einem dramatischen Bogen strukturiert ist, der aber auch gleichzeitig durchaus Handlung vorantreibt, also auch nicht vollends episch erzählt ist und der vor allem jede Menge Energie und performative Ideen ausstrahlt.
„Ein Mann seiner Klasse“ (Marc Brummund, 2024): Als Fernsehfilm hat die Verfilmung des grandiosen Christian-Baron-Buchs natürlich seine Limitierungen, die Darstellung von Klasse im Film über einstudierte Spielgesten und damit Reproduktion von Stereotypen hinweg so sehr zu transzendieren, wie es eine solch extreme Form von sozialer Armut, wie in Barons Buch angelegt, eigentlich dringend bräuchte, um sich dem Klischee zu entziehen. Für einen Fernsehfilm sind aber viele Dinge schon auch erfreulich angegangen. Die zeitlichen Verdichtungen funktionieren verlustfrei, die dramatische Anordnung der Szenen gegenüber dem Buch ist sinnvoll, Newcomer Camille Moltzen ist sensationell und der Cameo von Christian Baron charmant.
„Rumours“ (Guy Maddin & Galen Johnson, 2024): Es gibt hier ein paar allgemeine Rahmensetzungen, die sowohl intellektuell als auch komödisch wertvoll sind. Es hat z.B. eine gewisse godot’sche Komik, dass sich die Staatsrepräsentanten der G7 hier in diesem politischen Klamauktheaterstück im Grunde am meisten davor fürchten, irrelevant und irgendwie allein zu sein. Aber man muss sich schon durch eine Vielzahl ins Leere gehender Witze kämpfen, deren politischer Gehalt immer ein bisschen unklar ist, immer irgendwie Hybrid aus Anspielung auf reale Gegebenheit und gleichzeitiger Entfremdung, die die ganze Dechiffrierarbeit mühselig macht. Naja!
„Explanation For Everything“ (Gábor Reisz, 2023): Diskursanalyse als Stille-Post-Modell. „Explanation For Everything“ zeichnet die Wege eines Skandals nach, der durch das ideologie-getriebene Falsch-Verstehen seiner verschiedenen Nacherzählungen überhaupt erst zum Skandal aufschäumt. Gábor Reisz nimmt dabei keinen Blatt vor den Mund und verweist direkt namentlich auf Orban und Konsorten, was den Film politisch explizit und immer wieder auch schreiend komisch macht. Die besondere Grandezza dieses Films macht aber die Tatsache aus, dass „Explanation For Everything“ seinen diskursanalytischen Modellcharakter hinter einer multiperspektivischen Erzählung versteckt, die sich auch wirklich für seine verschiedenen Figuren interessiert, sie als Menschen denkt und so die Beschaffenheit des Diskursraums auch empathisch nachvollziehen kann. „Explanation For Everything“ ist also beides; Handlungsspielfilm und Systembeschau. So wird tatsächlich jede Parteinahme, jede weltanschauliche Abfälschung der Wirklichkeit, jede Überreaktion und jedes Aneinandervorbeileben und -reden in einer psychologischen und soziologischen Dimension verständlich. Würde es mehrere solcher Filme geben, man würde ihnen nicht müde werden.
„Carnage“ (Roman Polański, 2011): Dafür, dass „Carnage“ gerne für Filme mit einer ähnlichen, naheliegenden Prämisse, dernach Elternstreits als Projektionsflächen gesamtgesellschaftlicher Schlachtfelder dienen und damit eine systemtheoretische Dramaturgie ermöglichen, herhält, ist der Film eigentlich eine einzige Enttäuschung. Der verheißungsvolle Krieg zwischen dem akademischen Kleinbürgertum und der Wirtschaftsbourgeoisie wird von Polanski viel zu oft für blödsinnige Situationswitze hergeschenkt, die Figuren bleiben Bühnenschemen und der Film endet relativ plan- und witzlos. Shrug.
„Sin & Illy Still Alive“ (Maria Hengge, 2015): Selten wurde Kälte so atmosphärisch auf das Publikum übertragen wie in diesem Regie-Debüt und damit ist sowohl das Wetter als auch die übertragene soziale Kälte gemeint. In einer nicht immer meisterhaft, aber doch genügend radikal durchgesetzten Erzählgrammatik mit ungewöhnlichen, garstig-grautönigen Figuren ist „Sin & Illy Still Alive“ eine sehenswerte Milieustudie.
„Memory“ (Michel Franco, 2023): Michel Franco bleibt sich treu und baut ein weiteres Mal ein dunkles Geheimnis unter der Oberfläche seiner kühl komponierten Tableaus auf, das er dann disruptiv in einer Szene ausbrechen lässt. Ironischerweise ist besagte Szene die schwächste des Films, der bis dahin eine wirklich spannende Auseinandersetzung mit der Kraft der Erinnerung ist. Das gegenseitige Heilen zweier diametraler Erinnerungstypen, dem Dementen und dem Traumatisierten, führt Franco schließlich sogar zu einer Spitze, die innerhalb des Franco’schen Kinos ebenso ungewöhnlich ist wie für das intellektuelle Beziehungsdrama als solchem: einem waschechten Happy End.
„Green Border“ (Agnieszka Holland, 2023): Selten hat mich ein Film so positiv überrascht wie „Green Border“, denn dass ausgerechnet eine 75-jährige Regisseurin wie Agnieszka Holland, die seit Jahrzehnten keinen interessanten Film mehr gemacht hat, dem völlig totbespielten, von linksliberalen Klischees vollgesogenen Flüchtlingsdrama noch etwas Neues und Substanzielles hinzufügen hätte könne, überstieg meine Vorstellungen doch sehr. „Green Border“ hingegen ist tatsächlich ein großer Wurf auf allen Ebenen. Fast schon essayistisch kreist Holland den Gegenstand der Waldgrenze zwischen Weißrussland und Polen ein, erzählt verschiedene Perspektiven in einem atemberaubenden Realismus, der sich immer wieder in kleinen, feinen dramatischen Gesten neuerfindet. In den richtigen Momenten bringt Holland Spuren einer sozialistisch-humanistischen Autorinnenhaltung unter, ohne jemals (wie so häufig im Flüchtlingsdrama) dabei den geflüchteten Menschen auf der einen oder die Polizei auf der Seizte inszenatorisch zu heiligen oder zu diabolisieren. Die tragische Absurdität einer Grenze, in der menschliche Körper buchstäblich hin- und hergeworfen werden, spürt Holland aus einem meisterlichen Realismus heraus, der immer wieder Platz für das Wahrhaftige, das Menschliche, findet.
„The Substance“ (Coralie Fargeat, 2024): Formell hat Coralie Fargeat von den ganz Großen gelernt. Kubrick wird hier referenziert, Hitchcock und natürlich auch das Body-Horror-Urgestein David Cronenberg, sowie sein Sohn David Cronenberg, der jüngst ja den Body Horror ganz ähnlich intellektuell erneuert hat wie Fargeat und auch bildweltlich ganz ähnlich arbeitet. „The Substance“ lebt in jedem Fall von seiner beneidenswert vielseitigen Metapher. Denn in diesem Film geht es nur auf der Oberfläche um Schönheitsideale im Showbiz (über diese Welt scheint sich Fargeat mit überzeichneten Figuren und Konflikten geradezu lustig zu machen!) In diesem Gedankenspiel existiert ein junges schönes Ich neben einem alten hässlichen Ich, beide Ichs sind aber aufeinander angewiesen, das alte, ungeliebte Selbst-Ich muss also vom jungen Avatar-Ich gepflegt werden. An dieses Gedankenspiel lassen sich nun mindestens drei Allegorien anbinden, die allesamt gesellschaftlich relevant sind, wodurch sich wohl der enorme Erfolg von „The Substance“ auch für ein breites Publikum erklärt. Da ist einmal das transgenerationelle Verhältnis von Eltern zu Kindern, die in gewisser Weise auch als „jüngeres Ich“ fortleben, aber in einem moralischen Konflikt stehen, Zeit ihrer Jugend auch in Fürsorge und Liebe der Eltern stecken zu müssen (einmal sagt das alte Ich Elizabeth sogar ganz plastisch den Mutter-Satz „Ohne mich würdest du nicht existieren“, als sie ihr jüngeres Ich im Fernsehen sieht) Dann ist da zweitens der Konflikt zwischen Gegenwart und Zukunft, die hier parallel geschaltet werden und somit ganz direkt in Kommunikation miteinander stehen, wo sie das normalerweise nur abstrakt und hypothetisch tun (etwa im Klimadiskurs). Und letztlich, ganz wörtlich beim Titel genommen, ist „The Substance“ natürlich auch eine wunderbare Allegorie auf Drogenkonsum, in der das nüchterne und berauschte Ich schizophren auf zwei rivalisierende Ichs aufgeteilt wird, von denen das eine das andere kannibalisiert. Trotzdem bleibt „The Substance“ gegenüber einem sehr ähnlichen Film, nämlich „Possessor“ von Brandon Cronenberg — der vor nicht allzulanger Zeit ebenso das filmische Subjekt aufteilte — intellektuell zurück. Fargeats Gedankengebäude ist dann schwach, wenn es soziologisch sein will, denn das Gedankenexperiment von „Substance“ ist genuin philosophisch und keineswegs soziologisch. Wenn Fargeat die Handlung auf toxische Männlichkeit rückbindet, geht das nur auf Kosten eines mündigen Subjekts. Aber nur mit einem mündigen Subjekt tragen diese allegorischen Subjektspaltungen ihr volles Potenzial aus. Nur wenn sich dieser Film z.B. mit der Sucht an sich auseinandersetzt und nicht mit der Sucht als eine Ursache von wie auch immer gearteten Umständen. Immerhin sichert sich „The Substance“ durch eine Vielzahl von Ironisierungen und Übertreibungen vor einer allzu soziologischen Ernsthaftigkeit ab ,dazu gehört auch zweifellos das Ende, das es — wie der gesamte Film —tatsächlich schafft, effektiv gewissen Vorhersehbarkeiten entgegenzuwirken. So kommt es eben nicht zum Mord des einen Ichs gegenüber dem anderen, sondern es entsteht eine Missgeburt, ein Syntaxfehler von Körper, der in einem großen Finale dann auf anarchischste Weise implodiert. Damit verzichtet „The Substance“ zwar erzählerisch auf den vorhersehbaren Selbst-Mord, ein bisschen ist das aber auch eine konzeptuelle Kapitulation, wie sich also dieses Ideengebäude zu Ende denken ließe.
Hinweis zu den Bildrechten: © unterliegt ihren jeweiligen Besitzern, Benutzung bezieht sich auf das Zitatrecht