
Die Taviani-Brüder provozieren in ihrem Doku-Experiment Doppelbödigkeit.
Originaltitel: Cesare Deve Morire
Alternativtitel: Cäsar muss sterben
Produktionsland: Italien
Veröffentlichungsjahr: 2012
Regie: Paolo und Vittorio Taviani
Drehbuch: Paolo und Vittorio Taviani
Produktion: (Rai Cinema)
Kamera: Simone Zampagni
Montage: Roberto Perpignani
Musik: Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Darsteller: Salvatore Striano, Cosimo Rega, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca
Laufzeit: 76 Minuten
Zu Beginn sehen wir ein Theater in der römischen Strafanstakt Rebibbia, in dem gerade Shakespeares Stück Julius Cäsar aufgeführt wird. Als der Vorhang fällt, werden die Schauspieler auf der Bühne von Wachmännern abgeführt und in ihre Zellen gebracht. Cäsar muss sterben macht anschließend einen Zeitsprung sechs Monate zurück. Damals hatte der Gefängnisdirektor (Fabio Cavalli), der gleichzeitig Theaterregisseur ist, den Gefängnisinsassen vorgeschlagen, zusammen ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen. Schon bald finden sich die Rollen für Cäsar (Giovanni Arcuri), Brutus (Salvatore Striano) und Cassius (Cosima Rega). Während sie ihren Text in Angriff nehmen, fragen sie sich auch ständig, wer die anderen Insassen sind und was sie getan haben, um im Gefängnis zu sein. Dabei gibt es nicht immer Frieden unter den Gefangenen. Es kommt auch zu Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, weshalb die Aufführung am Ende am seidenen Faden schwebt.
Quelle: Moviepilot.de
Replik:
(ursprünglich erschienen als Post
im mittlerweile inaktiven Filmtiefen.de-Forum, 13.09.2013)
Abgesehen von Fatih Akin, der den Goldenen Bären 2004 gewinnen konnte, liegen deutsche Erfolge auf der Berlinale in lang zurückliegender Vergangenheit. In den 80ern bzw. den ausklingenden 70ern nämlich als Fassbinder, Schroeter, Lilienthal und Rainer Simon für ihre Kunst prämiert wurden. 2012 rechneten sich die Filmschaffenden der Berlinale-Heimat mal wieder Chancen aus: Mit Matthias Glasners „Gnade“, Hans-Christian Schmids „Was bleibt“ und vor allem mit Christian Petzolds „Barbara“ waren gleich drei vielversprechende Kandidaten im Bärenrennen vertreten, gewinnen sollte aber der Film „Cäsar muss sterben“ der Oldie-Regisseure Taviani, die ihren letzten europäischen A-Festival-Preis noch vor (!) der deutschen Berlinale-Blütezeit bereits 1977 in Cannes gewannen. Ein Sieg der erfahrenen Italiener gegen junge deutsche Herausforderer, der von vielen als „konservative Entscheidung“ abgetan wurde.

Häftlinge, eins mit ihrer Rolle
Die Tavianis begleiteten eine Gruppe an schwerkriminellen Häftlingen in einem römischen Gefängnis, die sich innerhalb eines Häftlingsprogramms für eine Aufführung des „Julius Cäsar“ von William Shakespeare meldeten. Hierbei verschwimmen die Grenzen zwischen Dokumentation, Improvisation und Schauspiel. Die Häftlinge sind tatsächliche Häftlinge, die sich selbst spielen, das Theaterstück ist hingegen von den Taviani-Brüder aufgegeben. Der Film zeigt faszinierender, aber auch nicht seltend enervierender Weise kaum die Häftlinge in ihrem Gefängnisalltag, sondern wie die Häftlinge vor der Aufführung des Stückes eins mit ihrer Rolle werden und man miträtseln kann, was dort tatsächlich gerade gespielt oder nicht wird, ob die Häftlinge gerade etwas von ihrer eigenen Person preisgeben oder sich lediglich hinter ihrer romanischen Rolle verbergen.
Kalkulierte Gedankenspielereien
Dass bei so einem filmischen Experiment nicht klar sein wird, was real und was nicht und sich daraus spannende Gedankenspielereien ergeben, dürfte natürlich einkalkuliert gewesen sein. „Cäsar muss sterben“ insistiert jedoch auf das lineare Abspielen des Cäsar-Programms, ohne Seitenblicke auf den Gefängnisalltag zu werfen, der vielleicht nicht weniger treffend darin gewesen wäre, Querverweise auf das Shakespeare-Stück zu liefern. So ist dieser Berlinale-Sieger eine seltsame Filmerfahrung, die leider auch streckenweise den Eindruck macht, dass den Taviani-Brüdern die Zufallsergebnisse der Dokumentation nicht reichten und man andersweitig nachhilfen musste. Da passt es auch, dass Salvatore Striano, der im Film den Brutus spielt, zwar Ex-Knacki ist, aber eben kein gegenwärtiger ist und daher als Katalysator die Ergebnisse des Gefängnis-Shakespeare-Experimentes verfälscht.
Ein Holzhammermoment
Die provozierte Doppelbödigkeit, der kranken und kriminellen Römer der Shakespeare-Tragödie, die von ebenso Kranken und Kriminellen gespielt wird, liefern natürlich Subtext. Wer sucht, der findet. So richtig zufrieden kann man mit „Cäsar muss sterben“ trotzdem nicht sein. Dazu trägt auch das von vielen Seiten zurecht getadelte Ende sein Übriges, in dem doch tatsächlich der letzte Häftling nach der Vorstellung wieder in seine Zelle eingeschlossen wird und sagt: „Erst seit ich die Kunst kenne, erscheint mir meine Zelle wie ein Gefängnis„. Und Abspann. Mehr Holzhammer geht nicht. Und wenn die Tavianis tatsächlich die „heilende Kraft der Kunst“ derartig als Essenz ihres Filmes herausstellen, sollte man sich zweimal überlegen, ob die Berlinale-Jury ihm nicht unrecht tat als sie ihn als besten Film auszeichnete. Shakespeare-Fans oder Kenner der italienischen Politik und Gesellschaft werden in diesem Film sicherlich interessante Details erkennen können, verreißen werden sie ihn kaum können, denn dazu wagen sich die Taviani-Brüder zu wenig aus der Deckung. Das Spätwerk der italienischen Regie-Brüder ist einen vorsichtigen Blick, aber sicher keinen Goldener Bären wert.
58%
Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Kaos Cinematografica / Stemal Entertainment / Le Talee / La Ribalta-Centro Studi Enrico Maria Salerno / Rai Cinema



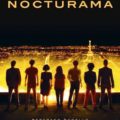
1 thought on “Caesar Must Die (quickshot)”