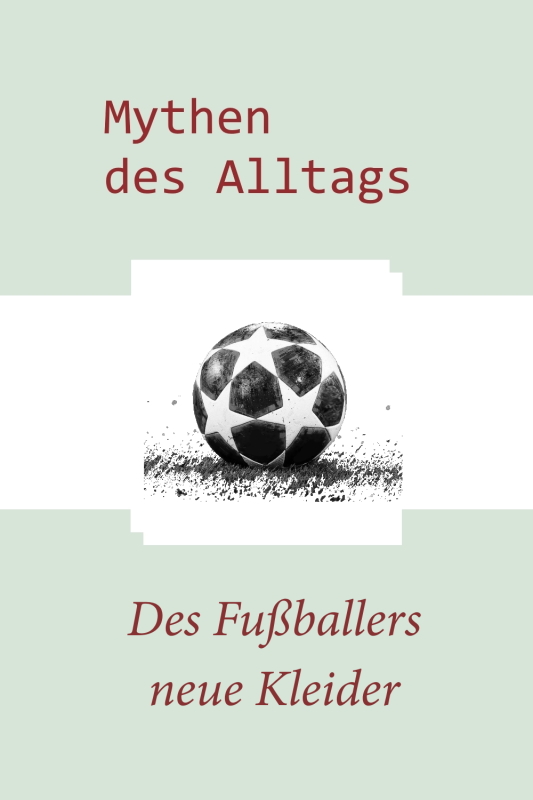
Der nackte Fußballspieler in Zeiten von Corona.
In Anspielung an den großen Roland Barthes möchte ich in dieser Rubrik über gesellschaftliche Mythen schreiben, die Barthes (in dieser Form) nicht mehr selbst miterlebt hat und sein Werk damit als Hommage weiterführen.
Es sagt viel über den Stellenwert des Fußballs in unser Gesellschaft aus, dass die Corona-Krise so prominent auch eine Krise des Fußballs war. Nirgends sonst hat sich so deutlich, ja so pornografisch, offenbart, was die schlagartige Veränderung einer Handvoll von Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens mit der Gesamtwirkung einer Gesellschaftsfigur macht. Der Fußball ist ein Mythos, über dessen Regeln jeder bestens Bescheid weiß und die dennoch nur dadurch bestehen können, dass sie als solche verdeckt werden. Wir wissen um die Millionengehälter, die Korruption, die heuchlerische Menschlichkeit in einem System, das auf Verschleiß und Ausbeutung basiert — aber wenn der Ball rollt, ist das alles für neunzig Minuten verdrängt. Der Verdrängungsmechanismus des Fußballs sind seine Wiederholungen des ewig selben, die sich ähnlich eines religiösen Kults zu etwas Unabänderlichen verdinglichen. Das man nur als Ganzes bejahen oder ablehnen kann, es aber dem gewollten Anschein nach nicht verändern kann. In Zeiten von Corona sind seine Rituale wie niemals zuvor aufgedeckt. Der Fußballer ist nackt wie der Kaiser in Hans Christian Andersens Märchen. Und wir müssen selbst wissen, ob wir die Pointe des Märchens gegen die Realität wenden oder Teil von ihr bleiben wollen.

Das Feiern des Ikons
Als Anfang des Jahres erst die Megamaschine ins Stottern gerat, dann stehen blieb und schließlich ohne Livepublikum wieder hochgefahren wurde, war das nackte Skelett des Fußballspielers sichtbar, das normalerweise durch seinen Mythos verdeckt wird. Die Meisterschaftsfeiern verkommen in diesen Tagen in ihren jubilatorischen Gesten zu einem lächerlichen Schauspiel. Die Pokale, die in den Himmel gehievt werden, während die Konfettimaschinen explodieren, können im Grunde genommen auch (goldene) Bananen oder Gehstöcke sein, da sie allein schon durch die Geste des In-den-Himmel-Streckens als solche symbolischen Objekte erkennbar sind. Ohne jubelnde Fanscharen sind diese Gesten hohl, übertrieben und wirken dabei wie von Kindern, die ihre Idole auf einem zuschauerlosen Bolzplatz nachspielen. Und im Grunde genommen ist auch der Fußballspieler selbst dieses imitierende Kind, nur, dass es sich selbst dabei imitiert, bzw. den gesellschaftlichen Spiegelstatus des eigenen Ichs. Als Sergio Ramos, Kapitän von Real Madrid, etwa vor ein paar Wochen den La-Liga-Pokal in den Himmel hebte, bewies er damit unfreiwilligerweise, dass er nicht selbst die Attraktion ist, sondern das Sergio-Ramos-Ikon, das er über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. In der Imitation seiner selbst, legt der Fußballer den hohlen Showcharakter seines Geschäfts frei. Während die Kamera in den Jahren vor Corona das Alibi hatte, ein unwichtiger Akteur und nur zweckgebunden zum Einfangen des Spektakels da zu sein, so zeigt sich nun eine peinliche Beichte: Nämlich die, dass der Medienapparat selbst das Spektakel ist. Ramos hat nie für die Fans im Stadion, sondern mehr für die Fernsehkamera, Pressefotografen und Instagram-Accounts die Pokale in den Himmel gehievt. In der Hypermedialisierung nähert sich die eigene Logik des medialisierten Referenzobjekts der des Mediums an und eignet sich eine hybride Logik zwischen Signifikat und Signifikant, zwischen Bezeichneten und Bezeichnendem, an.

Klassenerhalt statt Klassenkampf
Der Fußball folgt als eine der relevantesten und dabei kontrollierbarsten globalen Unterhaltungsindustrien dem Diktat, alles und jeden in ein Zeichen aufzulösen und damit in ein Koordinatensystem der Auswertbarkeit einzupflegen. Das Resultat ist eine Parallelwelt, in der alles einförmig-einstudiert zur strengen Obligation verkommt, der man sich nicht untreu machen sollte, möchte man weiterhin ein Teil des gelddruckenden Apparatus sein. Nicht zufällig sprechen Fußballer oft mit den Augen zum Boden gerichtet, konzentriert darin, anstoßlose Phrasen zu wiederholen — und erst nach ihrem Karriereende darüber, wie sie das Befolgen der strengen Regeln zu Depressionen und anderen psychischen Belastungen gebracht haben. Die Fans verhalten sich zu diesem Schauspiel schizophren: Einerseits gibt es immer wieder tiefe Sehnsüchte nach Authentizität und Ehrlichkeit, andererseits wird das „professionelle“ Verhalten oft, ohne es zu hinterfragen, als Tribut für das Verdienen von Millionen angesehen. Dem Übertreten dieser Regel reagiert man oft mit derselben hierarchistischen Leistungslogik wie die Fußballbranche selbst. „Unruhe reinbringen“ heißt es dann so oft, wenn eine Figur im Fußballzirkus mal abseits der Diskurssprache seine Meinung oder Haltung zum Ausdruck bringt. Die Fans sehnen sich nach der einfachen Dynamik eines authentischen Proletariersports, gleichzeitig verhalten sie sich gegenüber ihrer Idole aber wie ein Vorarbeiter des Managements.
Man könnte an dieser Stelle soziologisch weiterspekulieren, ob diese Schizophrenie vielleicht ein Spiegel der eigenen Bedürfnisse in der neoliberalen Arbeitswelt darstellt. Schließlich ist der Fußball doch seit jeher in jenen Gesellschaftsschichten besonders beliebt, die Roland Barthes hinblicklich seines Heimatslandes als classes populaires bezeichnen würde und die besonders prekär von der gegenwärtigen Leistungsgesellschaft betroffen sind: nämlich dem einfachen Volk der Arbeiter und Angestellten. Einerseits erkennt man den Fußballer als der eigenen Klasse zugehörig an und identifiziert sich positiv mit ihm; andererseits ist er auch ein Millionär und habe daher doch bitte sein Maul zu halten, wenn es ihm schlecht ginge, weil er echte Arbeit doch gar nicht kenne. Die Differenz des Einkommens, sowie die ungebrochene Assoziation des Fußballs mit Traumerfüllung und bezahltem Hobby verdecken hier, dass beide nicht nur tatsächlich zumindest nach kulturellen Kriterien häufig derselben Klasse angehören, sondern auch, dass der Fußballer, jeder verdienten Million zum Trotz, Teil desselben neoliberalen Hamsterrades ist, in dem der Mensch Körper und Seele vollprivatisieren muss, um sie den Regeln des Marktes zu unterwerfen. Von Außen betrachtet prügelt der eine Schwache traurigerweise auf den anderen ein, weil man sich durch die (ökonomische) Klassenschranke nicht als gleich erkennt. Stattdessen könnte man das System als solches in Frage stellen. Dazu müsste man verstehen, dass die Millionäre mit Ball am Fuß, ähnliche Ketten daran tragen, wie der Paketzusteller oder der Krankenpfleger.

Kommerzialisierung von Authentizität?
Denkbar ist lediglich, dass der Fußball sich sodann mehr für „Ehrlichkeit“ und „Aufrichtigkeit“ anfängt zu interessieren, wenn sich diese effektiver vermarkten ließe, als das glattgebügelte Produkt des kindlichen Ja-Sager-Fußballs. Nach dem Karriereende, in denen die Enfant Terribles und Eigenbrötler der Fußballbranche mit ihren Eigenheiten nicht mehr im Widerspruch zum sportlichen Erflolg stehen, scheinen sie auf einmal geradezu dazu angehalten, um sich auf die Weise medial zu zeigen, wie man sie zuvor immer schon andeutungsweise (aber eben nur andeutungsweise) gesehen hat. Die Skandalnudel Maradona, der dumm-naive Lukas Podolski, der liebenswert-übergewichtige Ailton, der Fliesentisch-Macho Mario Basler. Auch das Outing Thomas Hitzlspergers als schwul nach dem Karriereende und der darauffolgenden Zweitkarriere als TV-Experte lässt sich in diesen Dualismus eindenken, indem Devianz zunächst hinderlich und danach schlagartig vermarktbar ist.
Eine weitere Spielweise, das Interesse an Authentizität zu kommerzialisieren, wäre es, den Fußball zu einem reinen Show-Geschäft ähnlich der WWE zu machen. Das hätte mit Sport nichts mehr zu tun, wäre aber den gierigen Machtbestrebungen im Fußball durchaus zuzutrauen. Zum Beispiel durch das Konzept einer Super League der Topteams ohne Abstiegsregel, in der es zum Beispiel für eine Mannschaft (bzw. ein Franchise) durchaus verkraftbar wäre, einen Säufer in der Startelf zu haben, solang die Punkteverluste durch Werbeartikel ausgeglichen werden könnten. So oder so bleibt aber die Erkenntnis, dass die Fußballbranche derart durch und durch von neoliberalem Geist durchweht ist, dass Authentizität (man könnte es auch einfach Menschlichkeit nennen) nur in diesen beiden kommerzialisierbaren Sonderwegen überhaupt erwünscht ist. Was sonst bleibt sind die einstudierten Gesten.

Jubel als konventionalisierte Geste
Man könnte ein ganzes medienwissenschaftliches Lexikon der einstudierten Gesten füllen, das den Rahmen dieses Essays in jedem Fall sprengen würde. Aber nehmen wir mal exemplarisch den Torjubel. Als eine Geste, die durch die Kopplung an eine unverkennbar einfache Emotion der Freude, einen hohen naturalistischen Anspruch hegt, erlebte sie in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich nicht ohne Bezug auf Kommerzialisierung und Hyper-Medialisierung verstehen lässt. Schaut man sich Fußballspiele aus den 70ern an, springen die Fußballer nach dem Torerfolg meist in die Luft und heben ihre Hände über den Kopf, was man als einigermaßen authentischen Ausdruck sportlicher Freude lesen kann. Heutzutage ist der Torjubel eine zeitlich-kodierte, etwa einminütige Showeinlage, in der sich der Fußballer dem Publikum präsentieren kann. Sie bietet Raum für vermarktbare Signature Moves (der bekannteste ist wohl Cristiano Ronaldos SIUUUUU, bei dem er seine ganze Testosteron-Power mit Hochsprung und aufgerissenem Mund zur Schau trägt); diese Showeinlage kann aber auch andere Signa aufweisen, die auf bestimmte klar-definierte Bedeutungen verweisen. Das Küssen des Emblems bedeutet Treue zum Club, ein Wiegen der Hände die Geburt eines Sprösslings usw.
Selbst eine konventionalisierte Geste der Verzeihung gibt es, falls man gegen einen Ex-Club getroffen hat. So hebt man die Arme zu einer Verzeihungsgeste, ohne dabei zu lächeln (!), während man aber gleichzeitig zulässt, dass die Vereinskollegen lächelnd zum gemeinsamen Jubelritual herbeispringen. Diese Geste sagt keine reine Verzeihung aus, sondern ein Hybrid zwischen Freude und Entschuldigung. Der Freudenanteil wird dabei auf die Vereinskollegen ausgelagert. Interessant ist, dass selbst diese Geste dermaßen konventionalisiert ist, dass das Ausbleiben oder Variieren der Geste bereits ein Affront gegenüber dem ehemaligen Club darstellen würde und klar dekodierbar bedeutet: Ihr bedeutet mir nichts mehr. Die Entschuldigungsgeste beim Torjubel suggeriert damit gewissermaßen Treue zu beiden Clubs gleichzeitig; nicht unwichtig, falls noch nicht entschieden ist, bei welchem Club man nach der Karriere ins Management einsteigen möchte. Diese Gesten sind zitationsfähig. Sowohl werden sie von Amateurfußballern auf Bolzplätzen wiederholt — obwohl sie ohne Publikum gar keinen Sinn ergeben — als auch transmedial im Videospiel: Hier zeigen sich bereits Verschmelzungstendenzen zwischen Spiel und Realität, wie sie auch in Film und Fernsehen ein zeitgeitiges Phänomen darstellen. Immer „realistischer“ wird der Fußball auf der Spielekonsole dargestellt, dabei aber gesellschaftlich kaum bemerkt, wie nicht nur die Darstellungstechnologie immer realer wird, sondern auch andersherum der Fußballer immer irrealer, immer mehr nach der Logik des Computerspiels*, in seiner Showeinlage wird. Diese Wechselwirkungen verkürzen alles und jeden auf ein vermarktbares, berechenbares Ikon.
* Eine besonders absurde Meta-Ebene stellt in dieser Hinsicht der Torjubel des französischen Offensivspielers Antoinze Griezmann dar, da sich dieser auf das Videospiel Fortnite bezieht. Einerseits hat dieser Referenzcharakter innerhalb des kindgerechten Fußballdiskurses zu einer Kontroverse geführt, da dieses Spiel Gewaltanwendung beinhaltet, andererseits konnte dieses Absurdum innerhalb des Fußball-Videospiels FIFA noch nicht aufgelöst werden. Bislang ist eine Spiele-Referenz innerhalb eines anderen Spiels also noch keine Wirklichkeit geworden, für die Zukunft denkbar ist dieser Effekt aber allemal, sobald sich die wirtschaftlichen Interesse-Parteien im Hintergrund auf einen Darstellungsmodus einigen werden.

Der vulgäre nackte Körper leerer Ränge
In Corona-Zeiten findet zum ersten Mal ein sichtbarer Bruch mit diesem Mythos statt, weil die verselbsttändigende Bildermaschine Aussetzern und Hindernissen ausgesetzt ist. Einerseits findet rein diskursiv ein Denkbruch statt; etwa im Eingeständnis, dass die bezahlten Ablöse eben nicht „leistungsgerecht“, sondern längst gefährlich inflationiert sind. Was auch an der bislang leistungsgerecht argumentierbaren Argumentation kratzt, ein Mensch (oder seine Arbeit) könne 100 Millionen Euro (oder mehr) wert sein. Andererseits — und das ist medienwissenschaftlich viel bemerkenswerter — ist das Stadion als Ort des Fußballs in diesen Tagen leer und ohne die entgegenjubelnden Massen kann ein einziges Individuum nicht mehr als 100-Millionen-Euro-Mensch inszeniert werden. Der Sport wirkt auf einmal nicht mehr wie der reißende Gladiatorenkampf von Übermenschen, sondern wie das, was er darunterliegend seit Einführung des Berufsfußballs eigentlich schon immer gewesen ist: Eine professionalisierte, bierernste, manchmal auch geradewegs leidenschaftslose Arbeit. Aber mit dieser Realität lassen sich keine kleinen Jungs zum Träumen bewegen, keine Gladiatorenkleider am Merchandisingstand verkaufen, letztlich also kein Geld verdienen.
Die mediale Antwort auf das Ausbleiben des Jubels in Corona-Zeiten gleicht jetzt bemerkenswerter Weise der Zensur im Sexualdispositiv. Zwar wissen wir in einer aufgeklärten Gesellschaft über die Nacktheit des Menschen bestens Bescheid, aber wir dürfen den nackten Körper trotzdem nicht sehen und nur in bestimmten Orten und Weisen über ihn sprechen. So reagierten die europäischen Fußballligen und -vereine auf die ohren- und augen-enttäubende Stille der leeren Ränge teilweise mit Pappaufstellern im Stadion, teilweise mit digital eingefügten Zuschauern (!), teiweise sogar mit eingespielten Fangesängen (!!!). Niemand wird hier wirklich getäuscht;* kaum ein Fan über sechs Jahren wird diesen Trug als solchen nicht verstehen und doch: Der Fußball braucht die Begleiteffekte, auf die es seine Konsumenten Jahrzehnte hinweg konditioniert hat, weil sich der Fußball sonst nach banaler Arbeit anfühlt, obwohl jeder ohnehin um diese Wahrheit weiß. Das Absurde daran ist, dass etwa die digitalen Zuschauer nicht einmal den Eindruck erwecken sollen, echt zu sein. So sehen sie eher wie ein Pixelmeer, denn wirklich wie Menschenmassen aus. Es geht einzig und allein das peinliche, pornografische Gerippe des Stadions zu verbergen, dass dem Konsumenten nicht zugemutet werden kann, wie ein nackter Erwachsenenkörper einem Kind. Hier vermischt sich die Konditionierung an Bildtypen also bereits mit der transmedialen Erfahrung des Videospiels. Besser schlechte Pixelwellen im Stadion, als nur das blanke Stadion als ein Ort schnöder Arbeit. Auch die Technologie der lauter werdenden Fangesänge, proportional zum Vordringen des Balles zum Strafraum, wurde von Videospielen erfunden und nun also notgedrungen von der Fiktion in die Realität zurückversetzt, um die unzumutbare, vulgäre Stille zu zensieren. Der Fußball(er) hätte diese historische Chance nutzen können, die Nacktheit als einen neuen vorübergehenden Modus des Authentischen zu feiern, stattdessen hatte er zu große Angst, sich als gesellschaftlichen Mythos zu entnaturalisieren, als der nackte Mensch dazustehen, der der nackte Kaiser in Andersen Märchen natürlich auch schon immer gewesen ist.
*der Philosoph Robert Pfaller hat anschließend an den Psychoanalytiker Octave Mannoni vom „naiven Beobachter“ als eine Beobachtungsinstanz gesprochen, die das Objekt gleichzeitig vollständig durchschaut und sich trotzdem auf seinen Spielcharakter einlässt und somit gesellschaftliche Phänomene und ihre „Magie“ erst funktionstüchtig werden lässt. Zwar hat sich Pfaller äußerst affirmativ gegenüber dieser Figur geäußert (sein Beispiel ist z.B. das Verkleiden beim Karneval, das man durchschaut, aber dennoch genießen kann), man kann und sollte diese Gesellschaftsfigur aber auch negativ wenden, wenn der Charakter der Illusion auf die gesellschaftliche Beobachtungsfähigkeit beeinträchtigend wirkt und dabei rein wirtschaftlichen Interessen folgt. Das ist beim Fußball längst der Fall. Wir tun also gut daran, uns in diesem Fall in unserer Instanz als naiver Beobachter zu hinterfragen und einmal wirklich auf die nackte Wahrheit zu konzentrieren.
© Alle verlinkten Graphiken waren mit Verweis auf ihre Open-Source-Nutzung im Internet zu finden. Sollte dennoch ein Urheberrechtsanspruch erhoben werden, informieren Sie bitte zur Entfernung den Blogbetreiber.