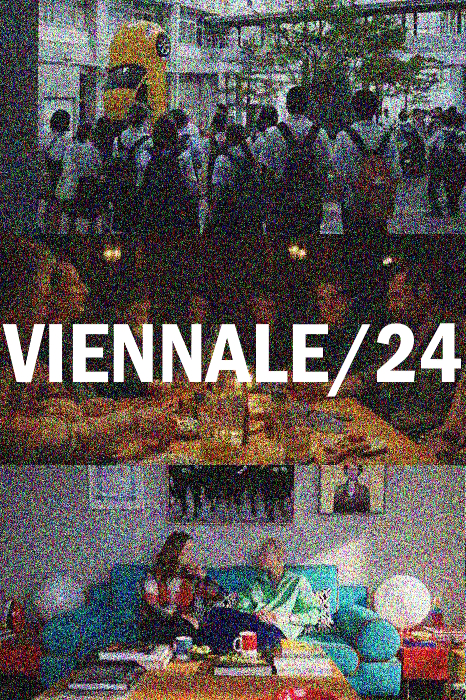
Sturzrevue & Kurzreplik — Viennale ’24
Das Oktober-Journal Teil 1 mit frischen Eindrücken der Viennale 2024.
„On Becoming A Guinea Fowl“ (Rungano Nyoni, 2024): Der Beginn ist maximal irritierend, warum trägt die Protagonistin so ein bescheuertes Kostüm, warum reagiert sie so kühl auf den Tod ihres Onkels? Und warum liegt er überhaupt da. Die ersten zwei Fragen klären sich auf, „On Becoming A Guinea Fowl“ handelt von innerfamiliärem sexuellen Missbrauch und wie dieser vom System „Familie“ überdeckt wird. Er ist dabei ethnographisch und auch durch die Position der Aufsteiger-Protagonistin klassensoziologisch präzise. Insbesondere die Szenen, in denen die gesamte afrikanische Familie in ihrer schieren Größe und Unübersichtlichkeit gezeigt werden, beeindrucken. Die sambische Antwort auf „Sieranevada“, in gewisser Weise. Was dem Film ein bisschen abgeht, ist eine Art dramatisch-motivische Weiterentwicklung des Grundkonflikts, der sich lediglich entfaltet, aber sehr statisch bleibt, die Handlung eben nicht antreibt. Dadurch bekommt „On Becoming A Guinea Fowl“ eine gewisse Epizitität, die dem Thema und dem sehr erwachsenen, stoisch ertragenen Umgang mit der Schwere des Skandals mehr als gerecht wird und sich in seinen Kamerabildern stilvoll spiegelt. Das Highlight ist eine Vater-Tochter-Szene, in der diese systemische Sprachlosigkeit ganz buchstäblich zum Ausdruck gebracht wird.
„Breathless“ (James Benning, 2024): Aufgabenstellung: Erstellen Sie ein Remake von Jean-Luc Godards „Breathless“. Die Mittel hierzu sind Ihnen völlig freigestellt.
James Benning: [gibt leeres Blatt Papier ab]
„Phantosmia“ (Lav Diaz, 2024): Das Prinzip Lav Diaz hat sich ein bisschen überlebt. Zwar kann man im Dickicht der mehrstündigen Erzählungen interessante Hermeneutiken vornehmen und freut sich ähnlich wie bei anderen Auteurs wie Hong Sang-Soo, die ihre eigene repetitive Marke geschaffen haben, über minimale Verschiebungen desselben (vielleicht ist der Sheriff Hilarion Zabala sogar ein wenig ein Alter Ego Lav Diaz‘ mit seinem altherrenhaften Moraltum gegenüber einer verkommenen Welt). Jedoch trägt es im Kern lange lange nicht mehr so zum erzählerischen Potenzial bei wie zu Diaz‘ Peak. „Phantosmia“ z.B. basiert auf Tagebucheinträgen eines historischen, philippinischen Scharfschützen, aber sowohl der geschichtlichen Rahmung, noch der Psychologie des Mannes, der Reue für den Mord an Dissidenten durchlebt, wird durch die Diaz’sche Form hier wirklich ausgeschöpft. Was hätte das für ein reicher Film sein können! Ein ehemaliger System-Killer will Buße vor sich selbst tun und bemerkt, dass die moralische Verloddertheit in der neuen Generation noch virulenter ist, ja, scheinbar systemisch zu dem (staatlichen) Exekutiv-Dispositiv dazugehört! Tatsächlich sehen wir hier aber wieder das Diaz’sche Planspiel, das mehr und mehr an Kinder erinnert, die mit Gewehren im Wald spielen. Mehr und mehr substituiert Diaz eine Form, die er einmal meisterhaft beherrschte zu einer rein bresson’schen Modellform. Und klar, auch das hat auch etwas (eben etwas radikal Neo-Bresson’sches) aber bricht man den Film auf seine textuelle Realität herunter (und entgegen eines Béla Tarrs z.B. besteht die Lav-Diaz-Welt ja viel weniger aus der Kontemplation langer Einstellungen, sondern tatsächlich aus epischer Erzählbreite!), dann ist ein Sheriff, der nach vier Stunden eine Prinzessin aus den Fängen eines Unholds befreit, ein wenig dünn.
„In Liebe, Eure Hilde“ (Andreas Dresen, 2024): Einer der besten Filme von Andreas-Dresen, denn Dresen vermag es hier, Widerstand gegen autoritäre Regime und dessen blutige Reaktion darauf in seiner Alltäglichkeit und Banalität zu zeigen, ihr damit einige Realitätseffekte hinzuzufügen und damit immersiv erfahrbar zu machen. Scheinbar von Dominik Grafs „Fabian“ gelernt, setzt Dresen auf frische inszenatorische Gesten, Figuren, Ausstattungen und Kostüme, um der Klischeefabrik Nazi-Film neue immersive Zugänge zu verleihen. Dabei reflektiert das Drehbuch von Laila Stieler auch die soziologischen Rahmenbedingungen der Handlung und zeigt auf, dass die lose Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ aus der Keimzelle eines hedonistischen Berliner Bürgertums entsprungen ist, im Grunde — könnte man sagen — ein Elitenprojekt gewesen ist. Die Hauptfigur Hilde ist davon aber ausgenommen, denn sie ist aber eigentlich nur eine Mitläuferin, die nur zufällig in die Gruppe hineingelangt. Ein bisschen prüde sei sie, hinterrücks wird sie „die Gouvernante“ genannt. Aber es ist gerade diese schüchterne, genügsame, ja, irgendwie durchschnittliche Hilde, die als perfekte Projektionsbrücke zwischen Publikum und Film wirkt, den Widerstand und Staatsterror geradewegs physisch erfahrbar zu machen. Eine Performance, so schlicht, schön und würdevoll, dass sie (im Gegensatz zu Meltem Kaptan) einen Deutschen Filmpreis verdient gehabt hätte.
„Lesson Learned“ (Bálint Szimler, 2024): Episch zerdehnt Regisseur Bálint Szimler seine Elemente, die wir überwiegend schon aus anderen Film kennen. Die idealistische Lehrerin z.B., die neu auf der Schule ist und gegen die mitunter schwarze Frontalunterrichtspädagogik mit neuen Methoden aufbegehrt und sich keine Freunde damit macht. Oder der neue Schüler in der Klasse, der irgendwie anders ist. Auf den Fährten dieser zwei Eindringlinge in das System „ungarische Schule“ verfolgt Szimler mal dieses, mal jenes und verdinglicht seine Handlung eher aus der formalästhetischen Logik des Bildes als aus einer wirklich narrativen Rhetorik. Manchmal übertreibt er es damit auch, etwa mit einer ellenlangen Theaterinszenierungssequenz. Insgesamt legt er aber eine mehr als vielversprechende erste Regie-Arbeit vor, aus der sich Ansätze einer handeigenen filmischen Methodik herauslesen lassen.
„Stranger Eyes“ (Yeo Siew Hua, 2024): Zwei junge Eltern sind auf der Suche nach ihrer verlorenen gegangenen Tochter und haben die ganze Zeit folgenden Gesichtsausdruck dabei: 😕 😕
Ein bis dato wohl maßlos überschätzter Filmemacher hat einen Film voller Zitate an Vorbilder wie Haneke, Hitchcock oder Kieslowski gemacht, der seine Schwächen gnadenlos aufdeckt. „Stranger Eyes“ ist eine reine Kopfgeburt von einem Film. Alle Motive und Figurenachsen sind intellektuell nett gedacht, aber machen emotional keinen Sinn, geschweige denn, dass sie gut inszeniert wären. Darüber hinaus ist der Film eine diskutable Teilrechtfertigung für Stalking und Überwachungstechnologie gleichermaßen (muss man auch erstmal hinkriegen)
„Who By Fire“ (Philippe Lesage, 2023): Das Scheitern dieses Films ist spannend und beim wiederholten Zusehen womöglich sogar aufschlussreich. Da entwickelt Philippe Lesage auf den ersten Minuten einen unglaublichen Sog, in dem alles möglich scheint, gesattelt von interessanten Figuren, starken Kameraeinstellungen und erzählerischer Unvorhersehbarkeit, nur um spätestens ab einer völlig unnötigen Sing-und-Tanz-Szene das Mojo komplett abzuschenken und nie wieder zurückzufinden. Denn spätestens ab dieser Stelle wird dem Film zum Verhängnis, dass es keinerlei dramatische, epische oder irgendwie anders geartete Sinnstruktur gäbe, die den Film im Inneren zusammenhält. Konflikte und Themen werden angerissen, fallen gelassen und dabei nicht immer emotional nachvollziehbar ausgefochten, dass die Erzählung den Bach runter geht und zu einem einzigen großen Chaos verkommt (warum z.B. ist Jeff persönlich so entrüstet, warum sieht er sich nach einer Abfuhr der jungen Aliocha so in seiner Ehre gekränkt,, dass von existenziellem Ausmaße heulen muss? usw.)
„The Room Next Door“ (Pedro Almodóvar, 2024): Pedro Almodovárs Stellenwert in der Filmkultur ist ein einziges, bürgerliches Klischee, das überholt und überdacht gehört. „The Room Next Door“ ist ein schlechter Film. Ein scheußlicher Film. Zunächst einmal ganz konkret auf seiner handwerklichen Ebene, ist es schon auffällig (und für meine Begriffe unverständlich), warum bei Almodovár große Kunst sein soll, was anderen Filmemachern als Fehler ausgelegt werden würde. Etwa, dass die Figuren in schlecht geschriebenen Dialoge ihre Subtexte und Vorgeschichten ausplaudern. Es geht weiter bei der Kamera, auf die sich jeder etwas einbildet, weil — ABER DIE FARBEN! — Almodovár eben gerne gelbe Bananenschalen in den Hintergrund stellt oder eine Figur mal eine türkise Jacke tragen lässt. Nichts ist daran wirklich gut. Es geht weiter: Die Handlungsebene. Es ist eine völlig kitischige Auseinandersetzung mit dem Tod, die darüber hinaus auch noch von einem sehr bürgerlichen Narzissmus herrührt. Oh neeeiiiin, Krebs, ja nee, dann muss ich mir wohl ein Haus im Wald kaufen und mich dort im richtig kuratierten Augenblick in Anwesenheit meiner Liebsten (oder auch nicht, mal sehen, mhmm) aus dem Leben kürzen. Ach, ach, ach, wie schwer hatte ich es im Leben, dass meine identisch wie ich aussehende Tochter und ich, nie zueinander gefunden haben, weil ihr Vater vom Vietnamkrieg so traumatisiert war, dass er Stimmen gehört hat und leidig bei einem Feuerwehreinsatz in einem random in einer Steppe vor sich herlodernden Haus ums Leben kommen musste (obwohl ja niemand dort drin war und er die Stimmen nur gehört hatte!!!). Ach, ach, ach. Überhaupt, ich war ja Kriegsberichterstatterin. Ein hartes Business, aber es gibt auch Schönes zu sehen, z.B. dass es dort auch manchmal queeren Sex unter Kollegen gibt. Ja, sonst gibt es als Kriegsberichterstatterin eigentlich nichts zu sehen. Queerer Sex unter Kollegen, wie gesagt, mhm, sonst kann ich mich an nichts mehr erinnern, aber der bosnische Befreiungskrieg gegen die bösen Serben, das war mein Krieg, ach, wie schön, ja. (Wo wir auch schon mitten in der politischen Dimension dieses Films wären:) Sterbehilfe ist wichtig! Und wenn jemand dagegen ist, ist er ein Nazi und ein religiöser Fanatiker. Almodovár schafft es sogar in einem Film, der dort prinzipiell kaum Raum für haben sollte, politische Schwarz-/Weiß-Bilder zu zeichnen: Wir gegen die. Wobei wir ja die Guten sind, ha! In „The Room Next Door“ versammelt sich auf unfreiwillige Weise alle längst zum Klischee versteinerten Denk-, Handels- und Gefüüüühlsmuster der westlichen bürgerlichen Gesellschaft. Völlig blind im eigenen (kulturellen) Narzissmus und damit auch völlig unfähig zu sehen, dass das ein niederträchtig schlechter, kitschiger und bescheuerter Film ist.
„Happyend“ (Neo Sora, 2024): „Happyend“ erinnert an Schlaglichter der japanischen Filmgeschichte und ist doch ein so eigenwilliger und unvergleichlicher Film, insbesondere in der so politikverdrossenen, konservativen japanischen Filmkultur. Denn Neo Soras Film ist ein genuin links-progressives, antiautoritätes Werk, das eine mehr als realistische Nahe-Zukunfts-Prognose gibt, nur um ihr eine glasklare Haltung und damit auch so etwas wie eine utopische Hoffnung entgegenzuhalten. Nein, das Social-Credit-System mit KI-gesteuerter Kameraüberwachung gibt es in Japan noch nicht, es wird aber — so viel darf man leider mutmaßen — bereits jetzt von rechtsgerichteten politischen Kräften in den Hinterzimmern der Republik(en) vorbereitet. Neo Sora lässt diese Überwachungstechnik in „Happyend“ von der einen auf die andere Nacht in einer Schule installieren und am rebellischen Aufbegehren der Jugend zerschellen. Dabei ist die Welt von „Happyend“ nicht nach einer rhetorischen Struktur geordnet, nichtmal in Schwarz/Weiß guter und böser Figuren unterteilt, sondern Sora sieht seinem fiktionalen Mikrokosmos fast schon dokudramatisch beim Wildwuchs zu. Die Rebellion gegen den Autoritarismus wird dadurch zu einem Beobachtungsspiel jugendlicher Natürlichkeit. Die Figuren reagieren mit einer unbekümmerten Anti-Haltung, die auf der Oberfläche lausbubenhaft und charmant, darunterliegend aber ein originäres antiautoritäres Potenzial hat (und das bereits im selben Moment auch schon als solches ausspielt wird), das eminent politisch ist. Dass man hier und da bei all den Figuren etwas orientierungslos wird, stört nicht weiter und trägt zum immersiven Effekt bei, irgendwie Teil dieser Welt sein zu können und zu wollen (worin natürlich auch ein agitatives Momentum liegt!) In diesem chaotisch-faszinierenden World Building erinnert der Film an Shunji Iwais Klassiker „All About Lily Chou-Chou“, in seiner kosmopolitischen Zukunftsdiagnostik auch an dessen „Swallowtail Butterfly“, in ihm atmet aber auch die jugendliche Wärme eines „Typhoon Clubs“ und nicht zuletzt eine politische Explizität, die man im japanischen Kino das letzte Mal wahrscheinlich bei Nagisa Oshima gesehen hat. „Happyend“ ist voller ikonischer Figuren und Momente, die von einer anderen Zukunft träumen lassen. Dieser Film kann tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen.
„All We Imagine As Light“ (Payal Kapadia, 2024): Bereits bevor es eine Szene gibt, in der die drei Hauptfiguren bei einem Gewerkschaftstreffen zuschauen, spürt man durch Payal Kapadias drittem Langfilm eine sozialistische Haltung durch. Kapadia, selbst ein Sprössling bürgerlicher Kreise, vermag es hier eine authentische Darstellung einer unteren Mittelklasse zu zeichnen, indem sie sich greifbar in die Lebensrealitäten der Krankenschwestern Anu, Prabha und Parvaty hineinsucht, die zu großen Teilen aus ihrer Arbeit bestehen. Der andere Teil ihres Lebens, das ist der Heiratsmarkt, wodurch natürlich das feministische Moment Einzug in den Film erhält. Prabha hat einen Mann in Deutschland, der sich nicht mehr bei ihr meldet und mit dem sie einst arrangiert verheiratet wurde. Die junge Mitbewohnerin Anu hingegen kostet ganz und gar ihre Jugend aus und steht schnell als unehrenhaft da, zumal sie heimlich einen Muslimen datet. Kapadia beobachtet dieses Dreiergespann und ihre Solidarität untereinander liebevoll und mit dem Gestus eines zeitlosen Realismus. Immer wieder sprengt Kapadia auch poetische Situationen wie kleine Epiphanien in die Handlung. Zwar flacht die Erzählung im letzten Drittel, der in der maritimen Provinz spielt, gegenüber den ersten zwei etwas ab, aber bis dahin haben wir tatsächlich ein wenig spüren können, wen oder was wir uns als Licht vorzustellen haben.
„Black Dog“ (Guan Hu, 2024): Dieser Film ist ein Phänomen. Ein solcher Film, wie man glaubt, es könnte keinen zweiten geben. Ein schweigsamer Held und ein tollwütiger Hund lernen hier einander kennen und (man könnte) sagen: lieben. Dabei sollte der Ex-Häftling Lang den Köter eigentlich einfangen und für die mitten in der Umsiedlung befindliche Gobi-Siedlung unschädlich machen. Hunderte Hunde sind hier zu sehen, durch Tier-Training, indes auch hin und wieder brillante Tricktechnik bewegen sie sich wie zugeschnitten auf die sensationellen Kameraarbeit und folgen doch einer ganz eigenen, poetischen Logik, die sich (für euro-zentrische Sehverhältnisse?) weit ab von einer reinen dramaturgischen Funktion bewegen. Die Momente situativer Komik und Tragik, die mit Leben und Sterben von Tieren immer einhergehen, stellt „Black Dog“ eh auch irgendwie her, aber mit einer gewissen Beiläufigkeit, als ob es immer auch etwas Wichtigeres zu erzählen gäbe: Eben das Große und Ganze. So findet Guan Hu immer wieder Zeit, um in der Gobi-Siedlung zu kreisen, Haussprengungen zu zeigen, in mafiöse Strukturen ein- und auszusteigen und schließlich in der chinesischen Sommerolympiade und einer Sonnenfinsternis zu gipfeln. For the sake of the sake. Aber darin entfaltet „Black Dog“ eben eine lyrische Strahlkraft, die eine synoptische Zusammenfassung weit übersteigt. Und ein bisschen ist „Black Dog“ natürlich auch ein Film über chinesische Siedlungspolitik; jede Zuschauerin kann jedenfalls selbst entscheiden wie viel politische Allegorie, ja, wie viel Mensch er eben im schwarzen Hund metaphorisch hineinlesen will (oder auch nicht).
„Eat The Night“ (Caroline Poggi & Jonathan Vinel, 2024): Man würde diesem Film Unrecht tun, ihn auf seine sehr explosive Dramaturgie und jugendliche Emphase zu reduzieren, die in der Tat eine gute Figur in der Berlinale-Generation-Sektion machen würde. Nein, man sollte das als Stärke begreifen. Denn tatsächlich ist „Eat The Night“ ein im positivsten Sinne pädagogischer Film, den man trotz seiner Brutalität, Sexualität und Gewaltdarstellung (oder gerade deswegen?) erwägen sollte, Jugendlichen im Alter von 14-16 zugänglich zu machen. Denn genau diese Altersgruppe wird hier nicht nur stilistisch, sondern eben auch pädagogisch adressiert: „Eat The Night“ seziert eine Gamification-Logik und kurz fühlt es sich für unseren Protagonisten, den Hobby-Dealer Pablo auch so an, als sei sein Leben ein bisschen wie ein Game. Aber das ist es nicht. Ohne echte Eltern-Institution in seinem Leben steuert er in eine Welt der organisierten Kleinkriminalität, die eben kein Spiel, sondern harte Realität ist, die keinen Spaß versteht. Zudem zieht er seinen Lover in diese düstere Welt hinein und alles endet in einer Katastrophe, die der Film bittersüß mit einer In-Game-Apokalypse überblendet, die ein Scheiß gegen die Wirklichkeit und gleichzeitig ihre beste Metapher ist. „Eat The Night“ profitiert extrem davon, dass die kleinkriminelle Welt authentisch und brutal geschildert ist. Mit dieser schonungslosen Genauigkeit nehmen die Regisseure dem Publikum jegliche Illusion, dass das Drogen-Ticken irgendwie doch ein buntes Abenteuer sein könnte. Viele Filme und Serien mit ähnlichem Thema scheitern an dieser Authentizitätshürde, weil sie diese Authentizität entweder nicht wollen oder inszenatorisch nicht hinbekommen (z.B. „How To Sell Drugs Online (Fast)“). Damit nicht genug ist „Eat The Night“ auch ein Film, der Queerness aus einer Position der Stärke erzählt, gezielt angesiedelt in einer harten Welt aus Klassenkampf, Rauschgift und Video Games triggert das Regie-Duo damit Wahrnehmungssphären moderner Männlichkeitswelten, die sich multipel in der Krise befinden. Die Verknüpfung von diesen Keimzeillen männlicher Toxizität mit alternativen Rollenbildern scheint als ein Lösungsweg am Ende durch die brutale Tristesse seiner Handlung durch. Und so überlebt hier vielleicht doch ein bisschen Hoffnung.
Hinweis zu den Bildrechten: © unterliegt ihren jeweiligen Besitzern, Benutzung bezieht sich auf das Zitatrecht